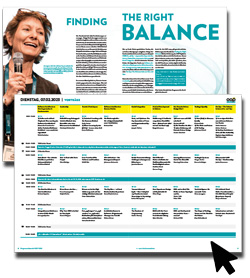Das gesamte Konferenzprogramm auf einem Blick? Kein Problem, alle Programminhalte finden Sie hier jetzt auch als praktische PDF-Broschüre ganz bequem zum durchscrollen, downloaden oder ausdrucken:
Zur PDF-Broschüre
Track: Software Architecture: New Approaches & Fundamentals
- Dienstag
07.02. - Mittwoch
08.02. - Donnerstag
09.02.
Software-Architektur ist allgegenwärtig. Trotzdem gibt es in vielen Organisationen kaum eine weitgehend anerkannte Definition der Rolle. Somit stellt sich die Frage, wie wir feststellen können, ob wir unseren Job "gut" machen.
In diesem Vortrag werden wir konkrete Wege kennenlernen, wie wir Architekturarbeit effektiv gestalten können. Wir streifen Themen wie Dokumentation, Entscheidungsfindung, Kommunikation und Skillset. Außerdem lernen wir Prinzipien kennen, die uns im Alltag als…
Mal angenommen, es gäbe ein (natürlich fiktives) Großprojekt zur Implementierung einer Microservices-Architektur. Die Entwickler:innen sind in zahlreichen Teams organisiert. Zudem gibt es ein übergreifendes Architekturgremium. Selbstverständlich wird auch ein proprietäres Framework programmiert. In jedem Team existiert die Rolle des "Technischen Architekten".
Kommt Ihnen das bekannt vor? Und haben Sie sich auch schon öfters gefragt, was er/sie eigentlich die ganze Zeit macht? In diesem…
Vor drei Jahren als Idee gestartet, gibt es heute viele Produkte & Unternehmen im Data-Bereich, die mit dem Mesh werben. Höchste Zeit zu schauen: Was ist die Kernidee? Welche Probleme soll es eigentlich lösen?
Was ist der Unterschied zwischen Mesh und Data Lake & Data Warehouse? Wie kann es technologisch umgesetzt werden und welche weiteren Bereiche müssen angegangen werden: Organisatorische Aspekte wie Teamschnitt & Skills, Abstimmung zwischen Teams und notwendige Skills in Produkt- und…
Many approaches to software architecture assume that architecture be planned at the beginning from the project's quality goals. This is problematic as the macroarchitecture is hard to change, and the quality goals it's based on tend to be unknown at the beginning of a project, or change later. Consequently, it would really be preferable if we could defer the macroarchitectural decisions until later.
This talk shows how to do this using systematic modelling and functional programming.
Target…
Integrationsarchitekturen sind der entscheidende Schlüssel in einer sich schnell entwickelnden Welt. Dabei ändern sich sowohl Geschäftsmodelle als auch technologische Grundlagen schnell und nachhaltig. Wir können aber nicht bei jeder Änderung die Software neu auf der grünen Wiese entwickeln.
Der Beitrag diskutiert den Prozess des Architekturdesigns und typische Integrationsmuster in hybriden Cloud- und On-Promise-Umgebungen.
Zielpublikum: Entwickler:innen, Architekt:innen
Voraussetzungen:…
API Expand Contract ist ein Pattern zur Weiterentwicklung von APIs. Aber was verbirgt sich hinter der Idee? Wie kann ich damit eine API weiterentwickeln, ohne dass Client und/oder Server im Wartungsaufwand alter Schnittstellen(-Versionen) ersticken?
In der Realität erweist sich Management von APIs und deren Versionen als gar nicht so einfach. Diese Session zeigt mögliche Wege und Alternativen, um der Versionierungshölle zu entkommen und dabei das oberste Gebot beim API-Design - nämlich „Don’t…
Microservices sind der Hammer, aber nicht alles ist ein Nagel. Trotzdem ist man leicht in der Versuchung, immer diesen Hammer auszupacken, wenn man eine gut modularisierte Software-Architektur zimmern will. Genau das hatten wir mit unserem System auch vor. Wir erzählen euch die Geschichte, warum wir unsere erste Entscheidung revidiert und mit modularen Monolithen ein passenderes Architektur-Werkzeug für uns gefunden haben.
Zielpublikum: Architekt:innen, Entwickler:innen
Voraussetzungen:…
With GraphQL a modern and flexible way of providing APIs for our data is emerging.
The clients specify which data they need, the provisioning of data becomes more flexible and dynamic. Over-fetching or under-fetching are history.
But does this mean we have to rewrite all APIs to benefit? How can we retrofit a GraphQL API onto our existing API landscape?
We will explore three different approaches.
Target Audience: Architects, Developers
Prerequisites: Basic knowledge in API design and Java
Level:…
How to structure your program right? This has been a central question since the beginning of software development. Layers are a start, but not enough. Hexagonal, Onion, and Clean Architecture have joined the club together with DDD's Tactical Design and Pattern Languages. Great system design is not achieved with one of these alone. Putting all the ingredients together we can build the Architecture Hamburger – the combination that makes high quality software possible.
Target Audience: Architects,…
One of the fundamental strategies of Agile Modeling is that artifacts, including architecture models, should be just barely good enough (JBGE). Another way of saying this is your models should be sufficient for the task at hand, no more and no less. But sufficiency is contextual in nature, it depends.
In this session we will look at the issue of model sufficiency, exploring the risk factors that motivate us to model more as well as the conditions that enable us to model less.
Target Audience:…
In a microservices architecture, services shall be as loosely coupled as possible. Still, they need to communicate with each other in order to fulfill business requirements. This talk will help you shape an answer for the typical questions (like shall I be synchronous or asynchronous and what's a good protocol to use?). You will better understand not only the architectural implications but also the effect on the productivity of your teams.
Target Audience: Developers, Architects
Prerequisites:…
APIs sind die Bindeglieder moderner Architekturen und nicht selten integriert ein System APIs im zweistelligen Bereich. Damit die API-Integration nicht zur Irrfahrt wird, unterstützen API-Guidelines die Developer Experience. Mit einem Blick auf öffentliche Guidelines und APIs gibt der Vortrag einen Eindruck von der allgemeinen Situation und liefert Impulse für das eigene API-Management. Da es in der Regel zu kurz gegriffen ist, einfach öffentliche API-Guidelines zu referenzieren, geben wir Tipps…
Eine der größten Herausforderungen im Systems Engineering ist die viel beschworene Beherrschung der Komplexität. Bisher in der Praxis etablierte Ansätze betrachten die Strukturierung von Anforderungen und die Dokumentation der Realisierung durch die entsprechenden Architekturelemente. Aber was ist mit den Testfällen, dem Feature-Tree für Produktvarianten und der Organisationsstruktur? Diese Strukturen gilt es im Rahmen der Systementwicklung angemessen zu berücksichtigen und nachvollziehbar mit…
Software Development based on a distributed architecture provides both several advantages and new challenges. In order to take advantage of the distribution it requires implementation of service discovery, routing, load-balancing, resilience mechanisms and more. These requirements can be covered by language frameworks or the underlying platform.
This talk will walk through a comparison of various approaches with focus on frameworks, Kubernetes and extending options like Service Meshes and eBPF.…