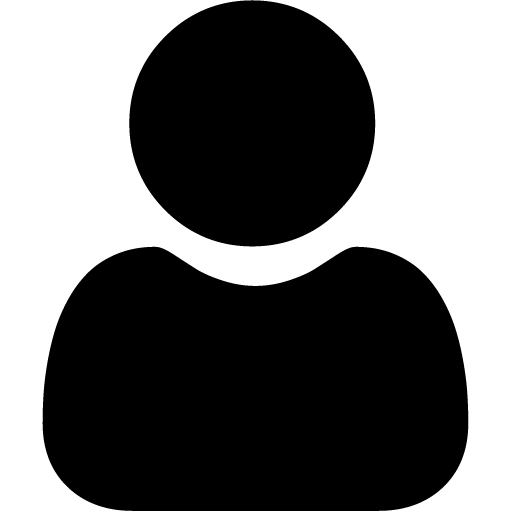Structural Detox: Wie uns Weglassen weiterbringt
In Organisationen neigen wir oft dazu, Komplexität hinzuzufügen statt zu entfernen – selbst wenn Weglassen effektiver wäre. Basierend auf Erkenntnissen zum „additiven Bias“ (Adams et al.) beleuchtet dieser Vortrag, welche Probleme das schafft. Wir zeigen, wie strategisches Weglassen und De-Implementieren zu agileren Prozessen führen kann und was dabei zu beachten ist. Wir ziehen hierfür Beispiele und Erkenntnisse aus unterschiedlichen Domänen wie Medizin oder Schule, aber auch IT-Organisationen heran.
Zielpublikum: Projektmanager, Agile Coaches, Führungskräfte, Entwickler
Voraussetzungen:keine
Level: Introductory
Extended Abstract:
Mein Vortrag adressiert eine grundlegende, oft übersehene Herausforderung in Organisationen und der Softwareentwicklung: die unbewusste Präferenz für additive Veränderungen gegenüber subtraktiven Maßnahmen. Basierend auf den bahnbrechenden Erkenntnissen aus dem "Nature"-Paper "People systematically overlook subtractive changes" (Adams et al.), beleuchte ich, warum wir tendenziell immer mehr hinzufügen, selbst wenn weniger effektiver wäre.
Wir starten mit einer Einführung in die psychologischen Mechanismen hinter diesem „Additions-Bias“. Anschließend tauchen wir in konkrete Problemfelder ein: von unnötigen Behandlungen in der Medizin über überladene Lehrpläne nach PISA bis hin zu aufgeblähten IT-Systemen und Organisationsstrukturen. Ich zeige auf, welche negativen Konsequenzen diese Anhäufung für Effizienz, Innovationsfähigkeit und Komplexität hat.
Im Kern des Vortrags steht die Frage: Warum fällt uns das Weglassen so unendlich schwer? Wir analysieren die psychologischen, kulturellen und systemischen Barrieren, die uns daran hindern, bewusst zu de-implementieren.
Als Ausweg stellen wir bewährte Ansätze vor: Wir blicken auf die erfolgreiche „Choosing Wisely“-Initiative in der Medizin und erste übertragbare Erfahrungen aus dem Bildungsbereich. Ergänzt wird dies durch eigene Initiativen und konkrete Beispiele, wie in Organisationen und der Softwareentwicklung bereits erfolgreich „de-implementiert“ wird.
Abschließend lade ich das Publikum zu einer kritischen Reflexion ein: Was können wir noch bewusster weglassen? Und vor allem: Was müsste sich in unseren Organisationen ändern, damit das Teilen von „Was nicht funktioniert hat“ oder „Was wir abgebaut haben“ zur Normalität wird?
Ziel des Vortrags ist es, eine neue Perspektive auf Komplexitätsreduktion zu eröffnen und das Publikum zu ermutigen, den Mut zum systematischen Weglassen zu entwickeln – für agilere Prozesse, schlankere Systeme und nachhaltigeren Erfolg.
Agile Coach, Trainer und in der Führungskräfte-Entwicklung
Für Fabian Schiller begann die agile Reise mit einem XP-Projekt im Jahr 2000. Seitdem erlebte er agile Methoden in verschiedenen Rollen, Branchen und Unternehmen. Heute arbeitet er freiberuflich als Agile Coach, Trainer und in der Führungskräfte-Entwicklung. Er ist Co-Initiator des „CoRe Day“ (Coach Reflection Day) und Autor des Buchs „Scrum Master Kompagnon“.
Vortrag Teilen
Wie die Natur Probleme löst – und was IT-Projekte daraus lernen können
Was haben Schwarmintelligenz, Chemotaxis oder evolutionäre Anpassung mit IT-Projekten zu tun? Dieser Beitrag zeigt, wie biologische Strategien zur Orientierung in unsicheren Umgebungen überraschende Parallelen zu modernen Projektmethoden wie Agile, Lean oder Design Thinking aufweisen – und wie diese Perspektive helfen kann, komplexe Projekte adaptiver, robuster und lernfähiger zu gestalten.
Zielpublikum: Interessierte, Entscheider, Projektleiter, Agilitätsanwender
Voraussetzungen:keine
Level: Practicing
Extended Abstract:
Biologische Systeme müssen permanent in unsicheren, dynamischen Umgebungen agieren. Dabei haben sich über Millionen Jahre erstaunlich effektive Such- und Anpassungsstrategien entwickelt – von der kollektiven Navigation eines Ameisenschwarms über die selektive Variation der Evolution bis hin zu fein austarierten Rückkopplungssystemen in Ökosystemen.
Auch IT-Projekte bewegen sich heute zunehmend in komplexen Kontexten, in denen klassische Planbarkeit an Grenzen stößt. Methoden wie Agile, Lean Startup oder Design Thinking setzen daher auf iterative Entwicklung, dezentrale Entscheidungen und kontinuierliches Lernen – Prinzipien, die biologischen Prozessen oft erstaunlich nahekommen.
Dieser Beitrag untersucht, wie sich zentrale biologische Such- und Anpassungsprinzipien – z. B. Schwarmintelligenz, Chemotaxis oder evolutionäre Selektion – als Metaphern und Modelle für moderne Projektmethoden interpretieren lassen. Ziel ist es nicht, biologische Abläufe 1:1 zu übertragen, sondern sie als Inspirationsquelle zu nutzen: für robustere Entscheidungslogik, effektives Feedback-Design und eine höhere Anpassungsfähigkeit von Teams in dynamischen Projektumfeldern.
Der Beitrag richtet sich an Projektleiter:innen, Innovationsverantwortliche und Organisationsentwickler:innen, die sich für systemische, interdisziplinäre Perspektiven auf Projektmanagement interessieren – und den Mut haben, von der Natur zu lernen.
Mitglied der Geschäftsleitung
Dr. Anna Melbinger hat viele Jahre als biologische, statistische Physikerin in der Wissenschaft geforscht, bevor sie vor zehn Jahren in die IT-Beratung wechselte. Seitdem begleitet sie mit besonderer Begeisterung komplexe Digitalisierungs- und KI-Projekte – gerade dort, wo Unsicherheit und Dynamik ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit erfordern.
Seit 2024 ist sie Mitglied der Geschäftsleitung der Xenium AG, einer mittelständischen IT-Beratungsfirma mit Fokus auf anspruchsvolle IT-Projekte an der Schnittstelle von Technik, Organisation und Mensch.
Vortrag Teilen